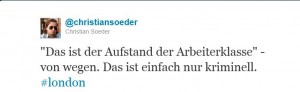Dezember 5th, 2011 § § permalink
Interessantes tut sich rund um die sogenannten Demokratisierungsversuche des Thalia Theaters – und es beginnt ein Theater rund um das Theater, das vermutlich weitaus interessanter ist als die Frage, was denn am Ende wirklich gewinnen wird. Natürlich ist Klugscheisserei hinterher einfacher als die solide Organisation eines Partizipationsprozesses – diese Einfachheit erlaube ich mir ebenso wie das Recht, meine anfängliche Beeindrucktheit jetzt der nüchternen Betrachtung weichen zu lassen. Denn zu beobachten ist hier zunächst ein zukünftiger Lehrbuchfall missverstandener Demokratisierung, den zu betrachten sich lohnt jenseits der bloßen und letztlich ziemlich irrelevanten Frage, was an einigen Abenden in einem Hamburger Theater demnächst läuft. Zudem ist hier das eigentlich erste Erscheinen eines zukunftsträchtigen Theaters festzustellen, von dem am Ende dieses Postings zu handeln sein wird.
Das Projekt: Mehr Demokratie gewagt – oder nur Lux und Dollerei?
Das Thalia beschreibt die Aktivität als Demokratisierung eines Dienstleistungsunternehmens. Der Intendant äußert hier im Interview sein Interesse daran, was denn das Publikum wirklich sehen will – und sei es Harry Potter. Anders ließe sich beschreiben: Die von einem demokratischen Gemeinwesen – der Stadt Hamburg – als verantwortliche Leiter einer städtischen Einrichtung Eingesetzten entziehen sich ein Stück weit der ihnen vom Gemeinwesen zugewiesenen Aufgabe der inhaltlich-konzeptionellen Ausrichtung dieser Institution und der damit verbundenen Verantwortung der von den Bewohnern des Gemeinwesens aufgebrachten Finanzmittel. Man lässt eine nicht begrenzte und undefinierte Gruppe von Menschen darüber entscheiden, was stattfinden soll. Wir spielen, was irgendwer will. Was auch immer, wer auch immer. Es muss nur eine ausreichend große Zahl von Stimmen zusammenkommen. Man könnte die Bewohner Hamburgs ebenso gut dazu verpflichten, Regenschirme aufzuspannen, wenn es in Australien regnet. Die Fremdbestimmung durch die – sich selbst als undemokratisch verstehende – Theaterleitung wird potenziell abgegeben in eine andere Fremdbestimmung durch irgendwen.
Was heißt demokratische Entscheidung? Wer entscheidet was für wen in demokratischen » Read the rest of this entry «
November 23rd, 2011 § § permalink
Anfang November rief das Hamburger Thalia Theater hier die Öffentlichkeit auf, vier Positionen des nächsten Spielplans zu bestimmen. Vermutlich stand im Hintergrund der Wunsch, der sich in verschiedenen Regionen der Welt, in der Occupy-Bewegung, in der Netzöffentlichkeit manifestierenden Beteiligungslust der Öffentlichkeit zu öffnen und selbst durch offene Partizipationsmöglichkeiten ein Stück offener und „demokratischer“ zu werden. Unter Missachtung aller Erfahrungen, die mit ähnlichen Crowdsourcing- und Consumer Empowerment-Aktivitäten vorliegen. Man stolpert einfachmal rein in Partizipationsdynamiken, in Netzbeteiligung und so eine Art Demokratie. Das mag man gutmütig als naiv bezeichnen – oder » Read the rest of this entry «
Oktober 10th, 2011 § § permalink
Bei Klaus Kusanwosky findet sich hier ein Beitrag über den Bundestrojaner, der nicht nur lesenswert ist, sondern gleichzeitig interessante Erweiterungen zulässt, führt man ihn eng mit Kusanowskys Ausführungen zum Dokument in der Moderne. Während Kusanowsky sich auf das Paar Freiheit/Sicherheit im Bezug auf das staatliche Gewaltmonopol widmet, scheint mir die Fortführung mit dem Blick auf den „Kriminellen“, von dem er spricht, den er aber nicht weiter definiert, vielversprechend.
Hätte die Polizei es mit Kriminellen zu tun, wären die Probleme erheblich geringer. Der „Kriminelle“ aber ist das Ergebnis eines Dokumentationsprozesses mit heutzutage höchst geregelten Verfahrensweisen zur Erzeugung des Dokuments „Kriminell“: Gemeint ist der Gerichtsprozess, der durch Richter durchgeführt das Verfahren umfasst, aus einem Beschuldigten oder „Angeklagten“ einen dokumentierten Kriminellen also Tatschuldigen zu machen. Bereits hier – und das ist vielleicht für den Dokumentbegriff selbst nicht ganz uninteressant – ist zu sehen, dass die Dokumente der Moderne niemals der Charakter der endgültigen Gültigkeit tragen können, sondern nur hohe Probabilität, die durch weitere Gerichtsinstanzen überprüfbar sein muss. Die Berufungsinstanz führt das Dokumentationsverfahren erneut durch. Die Revisionsinstanz wiederum überprüft lediglich, ob die Verfahrensdurchführung der Vorinstanz Dokumenterzeugungsgerecht operierte oder nicht. Darin liegt ein wichtiger Zug der Moderne. Sie erzeugt Dokumente – aber mit dem gleichzeitigen Bewusstsein, dass das Dokument nicht gültig sein könnte oder zu einem späteren Zeitpunkt (etwa durch das Auftauchen neuer Beweise durch neu zugelassene Beweisverfahren wie den DANN-Test) als ungültig erscheint, weil es noch immer von der Voraussetzungen, aus denen heraus es erzeugt wurde, abhängig bleibt.
Die göttlichen Gerichtsurteile des Vormittelalters suchten nach Letztgültigkeit – indem sie Gott zumuteten, in einen erwartbaren Ablauf (das Verbrennen eines Körpers im Feuer) einzugreifen und gegen natur- und menschenwissenschaftliche Erfahrung wundertätig die Nichtschuld zu beweisen. Erst in den Prozessen der Inquisition wurde dieses Verfahren insoweit abgewandelt, dass der Beschuldigte notwendig ein Geständnis ablegen musste, um vollgültig verurteilbar zu sein. Dass das nicht in blutrünstigen Folterorgien wahnsinniger Inquisitoren mündete, » Read the rest of this entry «
August 18th, 2011 § § permalink
In der neuesten ARD/ZDF-Onlinestudie bin ich über einen Vertipper gestolpert, der mir sehr gefiel:
Nicht nur die gelegentliche zeitversetzte Nutzung von Fernsehsendungen oder Ausschnitten daraus via Internat hat sich seit 2008 von 14 Prozent auf 29 Prozent verzweifacht, … (hier Seite 4f.)
Das „Internat“ ist ein wunderbares Bild für die traditionelle, dokumentbasierte Nation: Räumliches Zusammenwohnen unter Aufsicht von Autoritäten, Zugangs- und Ausgangsbeschränkungen und autoritäre Festlegungen sowohl der Formen und Regeln sowohl des Zusammenlebens als auch dessen, was zu lehren und zu lernen, zu wissen und zu können ist. Die Nation war (und ist noch) ein Internat, Internationalität die Zusammenarbeit von Internaten. (N.B.: Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass die erfolgreichste Romanserie der letzten Jahre gerade in einem Internat spielt, einem letzten zauberhaften Traum dieser nur noch als historische Wohlfühlreminiszenz taugenden Lebensform). Die Leitdifferenzen, die dieses Internat ausmachten, werden nun von der Internetionalität kassiert: Raumgrenzen, Autoritätspositionen, verbindliche Regeln und Wahrheiten finden sich nicht vor-geschrieben in der Netion. Weniger Organisation, ist sie eher Selbstorganisation oder Autopoiesis. Die herrschende Lehrmeinung wird zur geteilten Meinung, die verbindliche Erzählung wird, wie letztens geschrieben, in einem Geflecht von Erzählungen aufgelöst, die zwar noch erzählt werden, für die es aber immer schwieriger wird, sich durchzusetzen. Noch mag zeitversetztes Ansehen der Massenmedien einen Rest solcher Erzählmacht im Internat zeigen. Aber – aller litaneihaft wiederholten Beteuerungen in der ARD/ZDF-Studie zum Trotz – es wird mehr und mehre eine Erzählung unter vielen anderen. In der Studie heisst es auch (hier auf Seite 15):
Wenn es darum geht, ein Massenpublikum zu mobilisieren, reicht kein Medium an das Fernsehen heran.
Das ist natürlich eine wunderbare Verdrehung der Tatsachen – denn Massenmedien mobilisieren natürlich nicht wirklich. Es reicht vielmehr kein anderes Medium an die Fähigkeit der Massenmedien heran, die Massen zu immobilisieren. Man sitzt still im Internat eingesperrt und glotzt fern.
Endliche und unendliche Diskussion
Zu den Kernfähigkeiten der immobilisierenden Internation gehörte es, Diskussionen dramatisch aufzubereiten, auf den binären Entscheidungspunkt zuzuspitzen und dann durch Entscheidung zu beenden. Die Vielfalt des Stimmen- und Erzählungsgewirrs ist nichts Neues. Die Internation führte nur einen Prozess ein, der eben die Grautöne in Schwarz/Weiß überführte und dann Schwarz oder Weiß, Schwarz oder Rot als Kernalternativen herausstellte. Diese Reduktion fand insbesondere über die möglichst öffentliche Debatte (in Parlamenten oder Massenmedien) statt. Erst wird debattiert, dann kann abgestimmt werden. Und damit ist fest-gesetzt was Gesetz wird. Diese Fähigkeit eignet der Netion nicht, in der die Debatten ausufern durch tendenziell unendliche Vermehrung der Debattenteilnehmer, Debattenplattformen und Debattenbeiträge. Das ist das Problem, das sich mit der entstehenden Netion auftut und das nicht einfach » Read the rest of this entry «
August 14th, 2011 § § permalink
Von dem weissgarnix-Mitblogger Frank Lübberding ist in der FAZ hier ein Artikel zu lesen, in dem er mit gewisser Wut Medien Mitschuld gibt an den Verwerfungen an der Börse. Dabei scheint er diese Behauptung ansatzweise für ungeheuerlich oder skandalogen zu halten. Mit einer Formulierung, die hier aus dem Blog stammen könnte, schreibt er:
Die Finanzmärkte werden aber als ein […] Drama inszeniert. […]Die Medien lauschen jedem Statement und posaunen es in die Welt. Um die inhaltliche Relevanz solcher Stellungnahmen geht es nicht. Die größte Posaune in diesem Orchester ist der Online-Ticker. […] Jedes Katastrophen-Szenario bekommt seine Plausibilität, weil es mit den Erwartungen des Publikums übereinstimmt. Es ist süchtig geworden nach Neuigkeiten. So machen die Medien aus der Volatilität eines Handelstages ein Drama, das sich bestens vermarkten lässt
Und als eine Art Quintessenz lässt sich lesen:
Medien und Märkte leben in einer symbiotischen Beziehung.
Das klingt nach einer klugen Einsicht – aber das Rabbit Hole geht tiefer, als Lübberding zumindest an dieser Stelle andeutet. Es ist kein Zufall, dass der Begriff der Spekulation sowohl in der Finanzwelt wie in der Medienwelt gerade als Gesamtzustandsbeschreibung dienen kann. Sowohl die mediale als auch die finanzmarktliche Spekulation lässt sich von unsortierten Neuigkeiten (Lübberdings Live-Ticker) und Gerüchten zum Handeln verleiten. Der Börsianer kauft oder verkauft, der Journalist haut eine verkaufbare oder nicht-verkaufbare Meldung raus.
Märkte und Medien – und Politik
Das seltsame singulare tantum „die Märkte“ lebt mit dem anderen singulare tantum „die Medien“ nicht nur in einer symbiotischen Beziehung. Vielmehr sind mediale und märktliche Spekulation letzten Endes dasselbe. „Die Märkte“ reagieren auf Meldungen der Medien. Es gibt keinen Tradersaal ohne Ticker und Laufbänder, die aus Medieninhalten gespeist werden. Ähnlich den eingeblendeten Aktienkursen fungieren die durchlaufenden Meldungen aus den unterschiedlichen Quellen und Ecken der Welt als Handlungsgrundlage für Trader. „Die Märkte“ hängen ab von „den Medien“. Zugleich liefern sie wiederum Meldungen für „die Medien“. Gerade in scheinbar krisenhaften Situationen wie in den letzten Wochen konzentrieren sich „die Medien“ auf die Handelsverläufe an der Börse. „Der DAX“ wird mit seinen Bewegungen zum Hauptgegenstand der Live-Tickerei. Dabei ist der DAX selber nichts als ein kommunikationsermöglichendes Konstrukt. Wie andere Indices auch, bildet er eine mehr oder minder zufällige Auswahl von Unternehmens-Aktienwerten ab und generiert damit einen zeitlich darstellbaren Verlauf. Er hat keine Aussage – es sei denn, er wird in eine Erzählung integriert. Die Erzählung der gesamtwirtschaftlichen Situation und Entwicklung etwa. Diese Erzählung erzählen „die Medien“. Und sie erzählen sie im politischen Umfeld und leiten daraus Handlungsaufforderungen an „die Politik“ ab. Etwa diejenige, die Staatsverschuldung zu korrigieren.
Die “Entkopplung von der Realwirtschaft”
Gelegentlich lässt sich in Kommentaren die Diagnose oder die Kritik lesen und hören, dass „die Märkte“ sich von der Realwirtschaft abgekoppelt hätten. Darin schwingt die Erwartung mit, dass der Aktienwert eines Unternehmens gefälligst seine wirtschaftliche Situation wieder zu spiegeln habe. Als wäre der Aktienwert eine Art Wirtschaftsthermometer, das in einer quantifizierten Angabe unumstößlich zeigt, welchen Wert ein Unternehmen hat. So naiv das schon immer gewesen sein mag – diese Koppelung ist nur eine der möglichen Koppelungen. Notwendig war und ist sie nicht. Denn der Wert einer Aktie wird nicht von einer Ratingkommision bestimmt, sondern von Handelnden Akteuren, die den Preis der Aktie unter sich ausmachen. Die gelegentliche aufgeregte Verblüffung, dass Kurse „fundamental gesunder“ oder „grundsolider Unternehmen“, die vielleicht sogar konstanten Gewinn abwerfen, sinkt, während Phantasieunternehmen wie diejenigen der Hightech-Bubble vor der Jahrtausendwende, ins Unermessliche steigen, zeigt die noch vorhandene Naivität bei einigen Beobachtern. Sie sind den alten Erzählformen noch verhaftet. Sie glauben noch an das Drama.
Die Macht der Erzählung
In der Hochzeiten der Dokumentgesellschaft war es Aufgabe der Massenmedien, nicht nur die als Nachrichten zu präsentierenden Geschehnisse auszuwählen, sondern insbesondere auch, eine Geschichte daraus zu generieren, die sich von „Ausgabe zu Ausgabe“ (der Zeitung, der Radio- oder Fernsehnachrichtensendung) weiter erzählen ließ. Diese Geschichte setzte aus Geschehnissen an und leitete daraus Vorblicke auf möglicherweise Geschehendes bzw. Forderungen an die Akteure ab, wie denn zu handeln sei. Im Chaos des Alltags sorgt das Medium für Orientierung. Aus den Handlungsforderungen wird Druck auf verantwortliche politische Akteure generiert, indem man sich der willfährigen Opposition bedient. Irgendeiner von denen wird schon etwas fordern, das in die mediale Story passt.
Diese Erzählkunst war auch im Bereich der Börse gefragt. Die Kursbewegungen sollten von Zeichendeutern – den Auguren der römischen Antike durchaus vergleichbar – aufgenommen und in eine Erzählung eingefügt werden. Es sind die Erzählungen, die jeden Abend in den Börsenberichterstattungen der Fernsehkanäle stattfinden, ebenso die Erzählungen in den » Read the rest of this entry «
August 10th, 2011 § Kommentare deaktiviert für Feuer in London, Finanzkrise, Erzählmacht und ctrl-Gewinn § permalink
Im Diskussionsthread meines Gastbeitrags auf nachtkritik (hier) fragte ein Kommentator, ob jene im Artikel geforderte Konzentration des Theaters auf das umgebende Gesellschaftliche in der Netzgesellschaft eine Politisierung beinhalte. Ich hatte mit einem Link auf meinen zwei Jahre alten Text Das Politische zurück ins Theater (hier downloadbar) darauf geantwortet. Dort hatte ich am Beispiel der Geschichtenerstellung rund um den Amoklauf von Winnenden zu zeigen versucht, wie sehr sich das Politische gerade in der Genese eines verbindlichen Dramas zeigt und zugleich verbirgt – in der Dramaturgie. Angesichts von Ereignissen, die das geübte Erzählen der Medien herausfordern und zu unterbrechen scheinen, laufen die Print‑, Radio- und Massenmedien geradezu hysterisch zu einer Hochform auf, die sich darin zeigt, dass unterschiedliche Erzählungsansätze ausprobiert werden. Und gerade der genaue Blick auf diese Erzählungen und ihre Entstehung, ihre Dramaturgie und ihre Implikationen sind es, die ein Theater zu fokussieren hat, das das Politische aufnehmen will.
Wie wird „London“ beobachtet
Es ist bedauerlich, dass gerade jetzt Klaus Kusanowsky in eine Blogpause abgetaucht ist, wäre doch aus seinem scharfen Blick auf das Beobachten vermutlich einiges an provokanten Einsichten über die Form der Beobachtung dessen, was in London sich gerade vollzieht, zu erwarten. Wie beobachten Medien die Ereignisse in London, Manchester und Birmingham? Wie beschreiben sie ihre Beobachtung, welches Drama bauen sie daraus und versuchen, es als gültige Beobachtung zu etablieren? Wird die Geschichte von Unterprivilegierten erzählt, deren ungerichtete Wut sich nunmehr „blind“ in einem Aufstand entlädt – den Aufständen in Los Angeles 1992 oder der Pariser Banlieue vergleichbar? Handelt es sich um eine englische Form der Sozialproteste, wie sie auch in Spanien zu beobachten sind? Artikuliert sich hier also soziale Ungleichheit in flammenden Fanalen? Oder handelt es sich um „Banden“, die die gegenwärtige Unübersichtlichkeit, die Unfähigkeit der sommerlich schläfrigen Ordnungsautoritäten ausnutzen, um maifertags- und hooliganhafte Randale und Krawalle anzuzetteln? Die göttliche Ina Bergmann, vormalige Würstchenbudenbesitzerin in London und einzigartige Nachtjournal-Moderatorin des ZDF, die verlängertes Wachbleiben durch unvergleichlichen Moderationsstil und Kugelschreiberartistik belohnt, brachte Montagabend sowohl die Referenz auf L.A. und Paris wie auch die Beschreibung des Geschehens als Bandenkrawall. Noch ist die Erzählung nicht ganz fertig. Noch herrscht Unsicherheit über die Einordnung. Noch ist der Raum des Politischen offen und nicht gänzlich definiert.
Spiegel Online etwa schwankt in der Bewertung der Ereignisse ähnlich wie die „Märkte“, die sich gerade am DAX austobten:
Am 07.08. schrieb man: „Aufgebrachte Bewohner setzten in der Nacht zum Sonntag mindestens zwei Polizeiwagen, einen Doppeldeckerbus sowie ein Gebäude in Brand.“ (hier)
Am 08.08.: Beobachter erklärten, die Polizei hätte große Probleme gehabt, die Randalierer unter Kontrolle zu bekommen. (hier)
Am 09.08.: Plündernde und brandschatzende Banden, die in der Nacht zum Sonntag im Nordlondoner Stadtteil Tottenham die Randale begonnen hatten, waren schon in der Nacht zum Montag in weitere Stadtteile weitergezogen. (hier)
Auch am 09.08.: Warum explodiert die Gewalt in England? Das Gefälle zwischen Arm und Reich wird immer größer, ethnische Minderheiten fühlen sich gezielt schikaniert. Eine ganze Generation sieht sich abgehängt — und ist geeint im Hass auf Eliten und Polizei. (hier)
Beim Blogger christiansoeder findet der Zusammenprall der Erzählungen ein einem einzigen Tweet Platz:
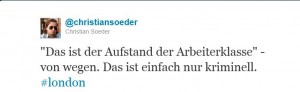
Es ist nicht einfach ein Wechsel des Beschreibungsvokabluars – sondern jede dieser Beschreibungen instituiert tendenziell ein Drama, dessen nächste Schritte bereits mehr oder minder unausgesprochen mitschwingen. Die dramatischen Formen sind zu sehr etabliert, um das zu übersehen. Mit „aufgebrachten Bewohnern“ ist anders zu verfahren, als mit „plündernden Banden“. Dabei geht es gar nicht darum, wer oder was die Beteiligten „wirklich“ oder „in Wahrheit“ sind. Das lässt sich von hier aus sowieso nicht beurteilen (das macht die Macht der Tele-Medien aus). Zudem lässt sich scheinbar auch kein „Anführer“ befragen, der erklären könnte, welchen Kollektivmotiven die Aktivitäten folgen. Es lässt sich aber sehr wohl erkennen, welche politischen Dimensionen dahinter stecken: Das Drama der „aufgebrachten Bewohner“ zöge nach sich eine Diagnose des » Read the rest of this entry «
August 4th, 2011 § Kommentare deaktiviert für Bild(ende Kunst) in der Netzgesellschaft — Von der Documenta zur unDocumenta § permalink
Um den sich wandelnden Umgang der (ehemaligen) Rezipienten mit Kunstwerken, die Verschiebung vom Kunst-Konsumenten hin zum Prosuementen lebensweltlich zu exemplifizieren, hatte ich meinem kurzen Kommentarwechsel mit Dirk Baecker noch Folgendes hinzugefügt:
Vielleicht als anekdotische Ergänzung dazu eine Beobachtung bei der letzten Documenta: Waren zuvor Besucher aufgefordert, sich kontemplativ oder mit anderen Besuchern diskursiv zu den Werken zu verhalten, so ließ sich bei der letzten Documenta (sic!) beobachten, dass die Besucher keinesfalls mehr passiv vor den Werken verharrten, sondern mithilfe von Handy und Digitalkameras Bilder von Bildern und Objekten machten, die sie in der Folge vielleicht nicht zu individualisierten Documentas im Netz machten, aber doch zu ihren je eigenen Ausstellungen und Kunstsammlungen. Als handele es sich um musikalische und filmische „Raubkopien“ werden die Besucher zu „Urhebern“ von Kunst-Mesh-Ups, die sich hinterher auf flickr, bei der nächsten Documenta vermutlich auf Facebook, G+ und wo auch immer finden, geshared, kommentiert und geliked werden. Das Publikum tritt damit (zum großen Unbehagen eines Anhängers der alten Kulturtechnik der Betrachtung von Kunstwerken) damit in einen Zwischenraum ein zwischen Kunstwerkproduzenten und Kunstwerkrezipienten. Sind diese Fotos Kunst? Dokumentieren sie Kunst? Dokumentieren sie die Anwesenheit des Rezipienten auf der Documenta? Wird das Netz zu einer Documenta 2.0? Mir gelingt darauf noch keine sichere Antwort.
Kulturindustrie unter (Nach-)druck
Dieses Fotografen-Szenario nun ging mir nicht mehr aus dem Kopf, weil sich hier m.E. Spannendes beobachten lässt. Musik‑, Film und Druckindustrie sind bereits seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an den Umgang mit Kopien gewohnt. Seit Tonband, Musicassette, iPod, seit VHS und Fotokopierer ist das Problem der technischen Kopierbarkeit des Kunstwerks virulent. Wirtschaftliche Einbußen und der Versuch sie zumindest teilweise durch GEMA, VG Wort usw. zu kompensieren inklusive.
Ton ohne knappe und verkaufbare Tonträger
Mit der konsequenten Digitalisierung und Vernetzung sind diese „Kreativindustrien“ einerseits in weitere Schwierigkeiten geraten, weil die sich abzeichnende Ablösung der Inhalte von ihrer Bindung an physische Trägermedien (Buch, DVD, Tonträger) und die damit einhergehende undendliche Vervielfältigung, die gar keine Vervielfältigung ist, weil jeder mit jedem die „Originaldatei“ tauscht und sie dabei zugleich behält. Wer einem anderen ein Buch lieh, hatte das Buch nicht mehr. Wer einem anderen eine Filmdatei gibt, behält sie selbst. Das hebelt das Gesetz der ökonomischen Knappheit aus.
Die Vergötterung des Originals
Zum Leitsymbol ökonomischer Knappheit allerdings wurde durch den Kunstmarkt des 20. Jahrhunderts das Werk der bildenden Kunst. Simples Kopieren oder Vervielfältigen war ausgeschlossen. Die wenigen Einzelfälle von „Fälschungen“ sind Legende. Nun tut sich aber in diesem Sektor Entscheidendes, das vermutlich weit über die bloßen Vervielfältigungsphänomene der anderen Künste » Read the rest of this entry «
August 2nd, 2011 § Kommentare deaktiviert für Einladung zur Diskussion auf Nachtkritik § permalink
nachtkritik.de hat heute morgen hier einen längeren Text von mir zur Debatte um das Stadttheater veröffentlicht, den unter anderem Dirk Baecker hier kommentiert hat. Darauf wiederum einige Anmerkungen von mir zurück. Ich verweise hier nur auf nachtkritik und lade zur dortigen Diskussion ein.
Juli 11th, 2011 § § permalink
Die „Inszenierung“ versucht auch zu versprechen, dass ich mir den Abend oder Monat aussuchen kann , also in eine von mehreren Vorstellungen gehen kann – und dennoch die „selbe“ Inszenierung sehe. Wieder einmal Ivan Nagel:
Interpretation als sinnvolles Denk- und Arbeitsmodell hat zwei Bedingungen: Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des theatralen Produkts. (Schriften zum Drama, 24)
Zwar hat spätestens Kierkegaard in „Die Wiederholung“ festgestellt, dass es gerade im Theater die Wiederholung nicht gibt. Das scheint aber denjenigen nicht zu betreffen, der nicht wiederholt, sondern einmalig in eine Inszenierung geht. Immerhin sehe ich noch dasselbe Werk. Dokumentationsmittel wie das Regiebuch sollen sicher stellen, dass eine Inszenierung wiederholbar ist, gar über Jahre oder Jahrzehnte auch mit wechselnden Darstellern/Sängern/Tänzern aufgeführt werden kann – und dabei dieselbe bleibt. Der Grundglaube der Industriegesellschaft, die überall wo „Nutella“ darauf steht erwartet, dass Nutella darin ist, die Produktidentität an jedem Ort und zu jeder Zeit garantiert, ist hier unverkennbar am Werke. Es ist die Dokumentkultur, die aus dem Zeitfluss ausbrechend versucht, die Aufführung zu einem wiederholbaren Algorithmus zu machen und doch nicht umhin kommt, anzuerkennen, dass selbst dieselbe Inszenierung von Abend zu Abend anders ist. Was sich aber nicht beobachten lässt, da der Beobachter nicht zweimal erstmals in den Zeitfluss steigen kann. Während zugleich die Theatermacher keine glaubwürdigen Auskunftgeber sind, weil für sie die Identität der Inszenierung schon immer ein Kampf gegen Windmühlenfügel war, den sie nicht gewinnen konnten. Der theatereigene Begriff der Indisponiertheit, der also voraussetzt, es gäbe eine Disposition zur identischen Wiederholung, zeugt von diesem Kampf.
Nach der identischen Inszenierung
Das Abrücken vom Inszenierungsbegriff würde Schluss machen können mit dieser Vergeudung. Anstatt die Energie darein zu setzen, immer wieder Selbes herzustellen, kann sie ihre Bahnen in der Freiheit der Andersheit suchen. Keine Identitätsgarantie. Nicht unbedingt als Aufforderung zum Extemporé und zur Improvisation. Sondern zum Im-Proviso: Zum Un-Vorhergesehenen und Un-Vorgesehenen, zum Un-Nachsehbaren zugleich. Jenseits des Vor-Geschriebenen Programmes als auch das Un-Vorgesehene geschehen lassen, nicht als Kadenz oder Freiraum für Solisten. Sondern als die Freiheit des Vollzuges, dem Fußballspiel gleich, das zwar seine festgelegten Regeln und seine trainierten Spielzüge hat, sich aber in situ dennoch mit einer gewissen Freiheit entfalten kann. Die Andersehit des nächsten Abends nicht betrachtend als Misslingen der Selbigkeit und Identität, sondern als Freiheit zum Anderen.
Ivan Nagels Hinweis auf das Spiel fortführen
Das Spiel. Ivan Nagel hat es (ebenfalls) ins Spiel gebracht. Das Spiel ist » Read the rest of this entry «
Juli 10th, 2011 § Kommentare deaktiviert für Mensch, Ivan Nagel … § permalink
… mit 80 Jahren bist du frischer in der Birne, als die Frischlinge, die an deutsche Großtheater schluffen:
Darf das Großtheater mit seinem dreißig- bis fünfzigköpfigen Ensemble, mit eigenen Werkstätten und Verwaltungen weiter als Vorbild alles höheren Strebens in der Schauspielkunst gelten? Drama und Theater wirkten aus diesem System einst kraftvoll in das öffentliche Bewusstsein. Von solcher Wirkung scheint wenig übrig geblieben. […] Technische Beschleunigung und politischer Abbau der letzten Jahrzehnte haben zwei Generationen in eine Mediengalaxie gestoßen, deren immer raschere Umschwünge zugleich totale Gegenwart und leere Zeitlosigkeit erzeugen. Die Millisekunden der Atome, die Jahrmilliarden der Biomoleküle wimmeln von Ereignissen, die mit dem Leben des Einzelnen unvergleichbar sind. Geht das Repertoire-Spiel nicht an alldem vorbei, wenn seine Programm-Melange die Gegenwart weiter als das erlebbare Treffen von Vergangenem und Zukünftigem behauptet? Die Muss-Klassiker, die das deutsche Stadttehater jährlich hundertweise von Regisseuren unter vierzig produzieren lässt, sind oft von verdrießlicher Sinnlosigkeit. […] Wie mancher Regisseur an manches Stück geraten ist, bleibt oft ein Rätsel, das die Aufführung nicht löst.” (Schriften zum Drama, 30ff)
Nur eines noch dazu: Die Inszenierung von Ü40-Regisseuren sind auch nicht besser.